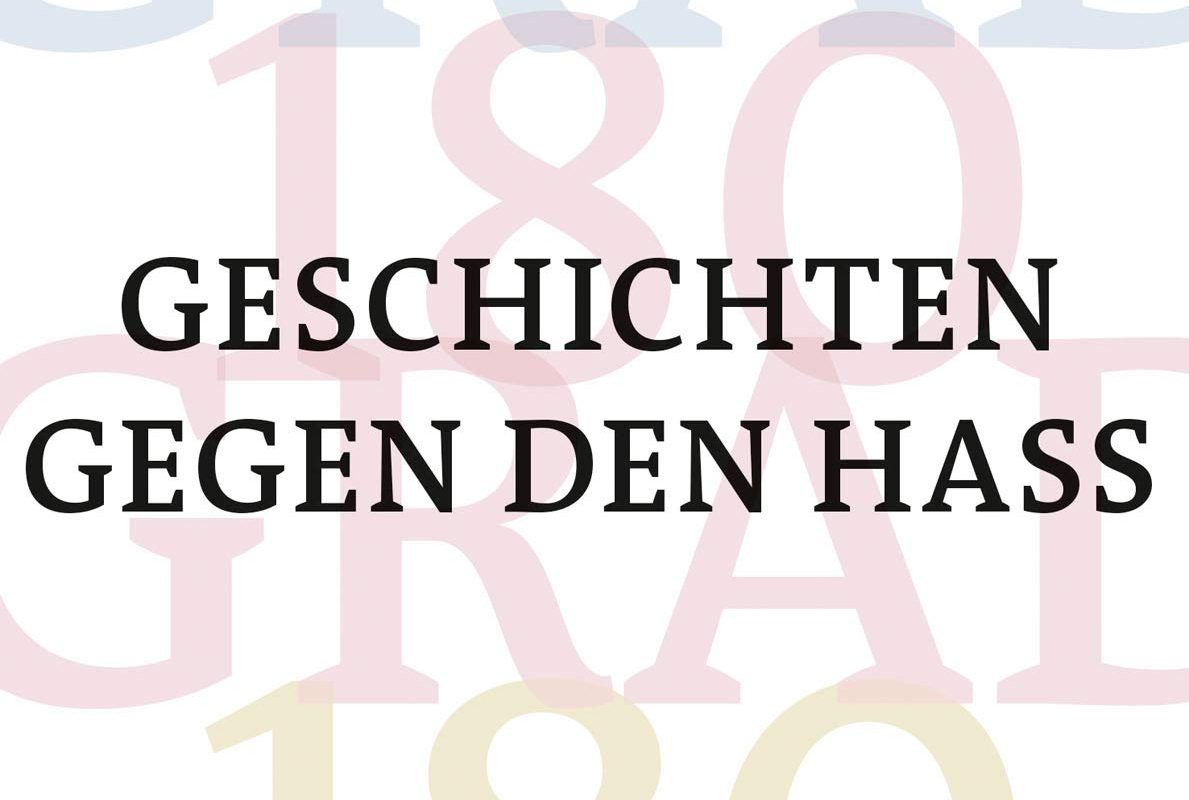Meinungsfreiheit
Wenn Menschen öffentlich, speziell in sozialen Medien, Meinungen äußern, die andere verletzen und abwerten, tun sie dies oft in der Überzeugung, ihre Meinungsfreiheit wahrzunehmen. Motto: das wird man ja wohl noch sagen dürfen, wir leben ja in einer Demokratie. Aus meiner Sicht ist das eine stark verkürzte Vorstellung von Meinungsfreiheit.
Meinungsfreiheit bedeutet nicht nur, seine eigene Meinung sagen zu dürfen, sie muss auch die Wirkung auf Andere berücksichtigen, gerade wenn es um Schwächere geht. Zu Meinungsfreiheit gehört auch, die Meinungen anderer anzuerkennen und zuzulassen. Es bedeutet, sich einer Auseinandersetzung zu stellen und die Bereitschaft, seine Meinung in einer Diskussion auch zu ändern, weiterzuentwickeln. Das heißt, es geht nicht nur um die Freiheit der Meinung, sondern auch um die Verantwortung die damit verbunden ist.
Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut, das auf den fruchtbaren Boden einer vorherigen kritischen Auseinandersetzung mit verschiedenen Meinungen und Perspektiven aufbaut. Meinungsfreiheit ist obsolet, wenn von vielen Positionen nur eine bestimmte und ihre Spielarten immer wieder ventiliert und konsumiert wird.
(Magdalena Modler El-Abdaoui, Haus der Begegnung)
Gemeinwohl
Gerade in Zeiten von Corona (aber auch sonst) gibt es viele, die gegen „die Mächtigen, die Eliten, das Establishment“ auftreten. Vor allem Verschwörungstheortiker gefallen sich in dieser Haltung (aber sie sind nicht allein). Opposition aber ist nur dann in Ordnung, wenn man nicht einfach dagegen ist, sondern auch konstruktive Alternativen aufzeigt, und wenn die Auseinandersetzung dazu neue Wege erschließt. Radikalopposition allein geht ins Leere. Und hier kommt der Begriff des Gemeinwohls ins Spiel: Es kann und darf nicht nur um individuelle oder Gruppeninteressen gehen. Wenn unsere Gesellschaft sich positiv weiterentwicklen soll – für alle, die hier leben – dann muss auch dieses gesamtgesellschaftliche Interesse thematisiert und diskutiert werden. Voraussetzung dafür ist ein Gefühl der Zugehörigkeit für alle, die in dieser Gesellschaft leben. Wer sich ausgeschlossen fühlt – als AusländerIn, aus sozialen Gründen, wegen mangelnder Möglchkeit der Teilnahme an politischen Entscheidungen – ist nicht interessiert, sich für das große Ganze einzusetzen. Voraussetzung ist außerdem eine konstruktive Auseinandersetzung darüber, was das Gemeinwohl ist, was also für das Zusammenleben in einer Gesellschaft und für die positive Entwicklung dieser Gesellschaft essentiell ist.
Begegnung – Vorurteile
Gegensätzliche Meinungen, unvereinbare Positionen, Unverständnis für „die Anderen“, Vorurteile und Feindseligkeit – in der Corona-Krise zeigen sich gesellschaftliche Tendenzen, die wir schon länger beobachten, in aller Härte. Eine dieser Tendenzen ist unsere Unfähigkeit, mit Andersdenkenden ins Gespräch zu kommen. Wir fühlen uns wohler in unserer Meinungsblase und tauschen uns gern mit Menschen aus, die ähnlich denken wie wir. Die Auseinandersetzung mit Menschen mit anderen Meinungen aber scheuen wir: zu herausfordernd, zu unbequem.
Was aber durch diesen Verbleib in der eigenen Blase unweigerlich entsteht, sind Vorurteile. Weil wir „die Anderen“ nicht mehr wirklich kennenlernen, machen wir uns ein Bild von ihnen – das aber meist nicht der Realität entspricht. Das betrifft nicht nur AusländerInnen, sondern immer mehr auch Menschen mit anderen Wertvorstellungen, anderen politischen Haltungen und anderen religiösen Vorstellungen – Menschen, die nicht zu „unserer Blase“ gehören, sondern die sich in einer anderen Blase bewegen.
Ein gutes Beispiel dafür sind die heftigen Auseinandersetzungen in Sachen Corona: auf der einen Seite stehen „die Naiven, Gutgläubigen“, die alles glauben und sich von der Regierung gängeln lassen. Und auf der anderen Seite die „Aluhutträger, die Verschwörungstheoretiker“, die keinen sachlichen Argumenten zugänglich sind. Problematisch daran sind weniger die unterschiedlichen, ja gegensätzlichen Positionen, sondern die Unfähighkeit, tatsächlich miteinander ins Gespräch zu kommen.
Man könnte daran verzweifeln – wenn es nicht Beispiele dafür geben würde, dass es auch anders geht. Solche Beispiele hat der Journalist Bastian Berbner gesucht, die Hintergründe recherchiert und das Ergebnis in seinem Buch „Geschichten gegen den Hass – Von Menschen, die ihre Vorurteile überwinden“ zusammengefasst. Es sind bewegende und mutmachende Geschichten von Menschen, aber auch Gesellschaften, die entgegen aller Erwartung zusammengefunden haben.
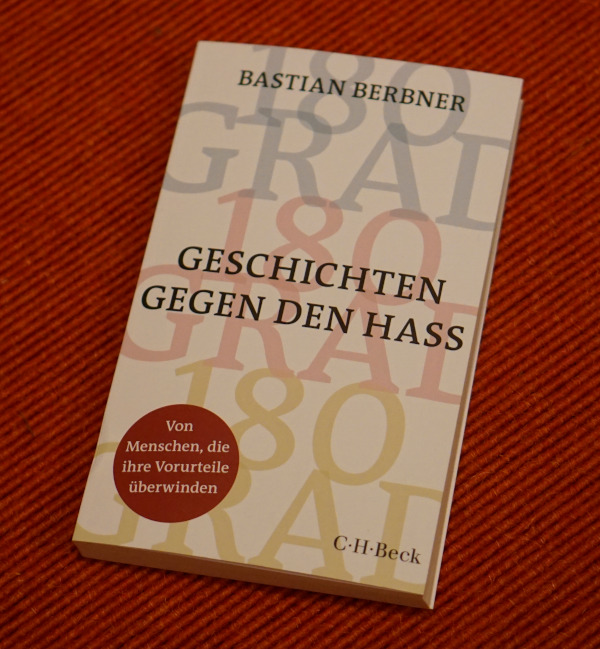

 von
von